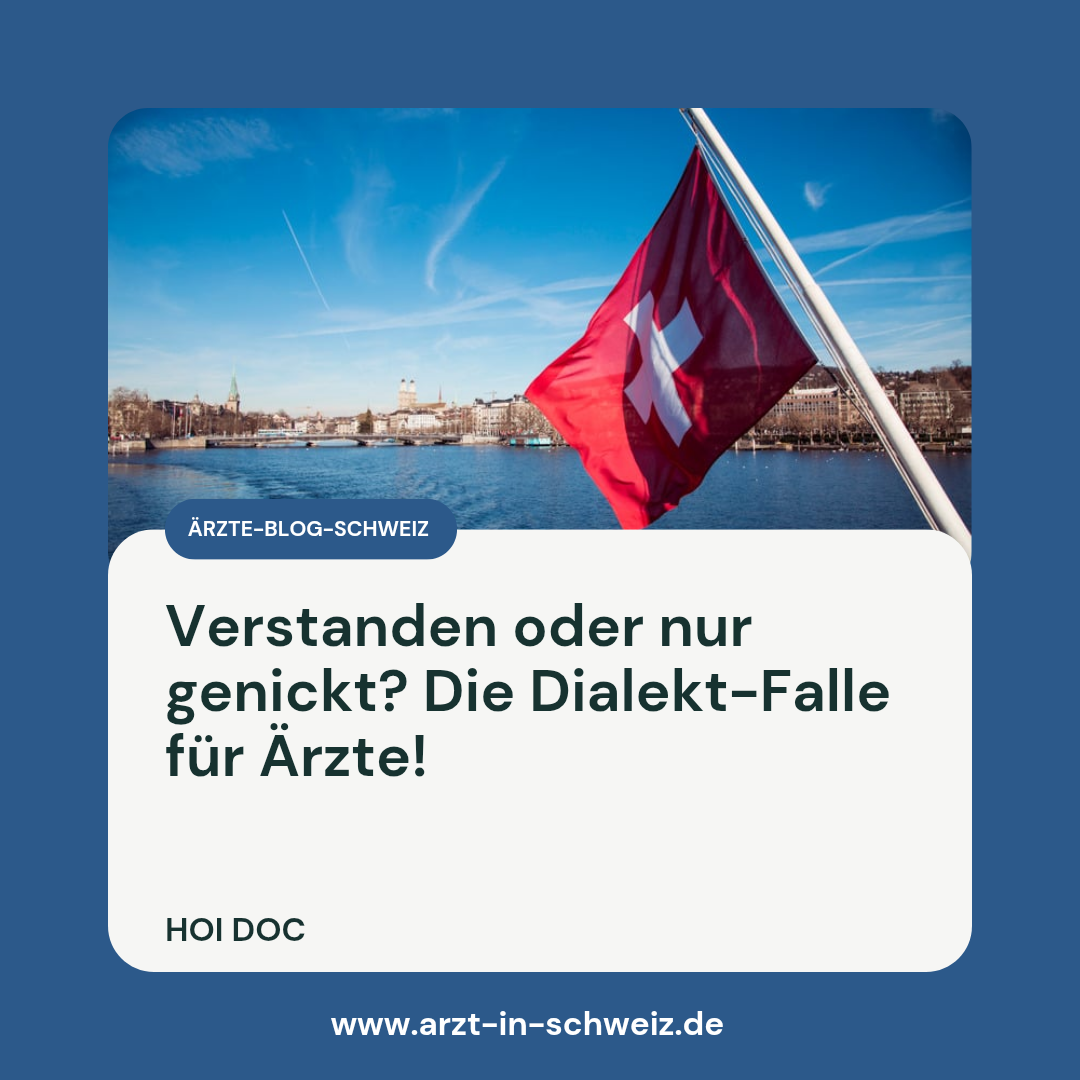
Schweizerdeutsch im Arztalltag: Verstehen statt nur nicken
Share
Schweizerdeutsch vs. Hochdeutsch im Arztalltag – was Patienten wirklich verstehen (und was nicht)
Stell dir vor, du sitzt als deutscher Arzt zum ersten Mal in einer Schweizer Praxis. Die Patientin kommt rein, setzt sich hin und sagt im breitesten Dialekt: „Grüezi, mir hets scho lang druckt im Brustchörbli.“
Du hörst zu, nickst – und fragst dich innerlich: Brustkorb? Herz? Oder meint sie etwas ganz anderes? Genau in solchen Momenten merkst du: Schweizerdeutsch ist mehr als nur ein netter Dialekt – es ist eine eigene Sprachwelt.
Warum Schweizerdeutsch so wichtig ist
Viele Ärzte denken am Anfang: „Alle Schweizer verstehen doch Hochdeutsch.“ Das stimmt zwar, aber für viele Patienten wirkt Hochdeutsch distanziert. Sie öffnen sich anders, wenn du wenigstens ein paar Dialektwörter oder Redewendungen verstehst.
Ein Beispiel aus meiner Beratung: Ein Arzt erzählte mir, dass er bei einer älteren Patientin lange nachgefragt hat, weil er nicht wusste, dass „mir isch schwindlig, wänn i uufstoh“ einfach „mir wird beim Aufstehen schwindlig“ heißt. Die Patientin fand’s nicht schlimm – im Gegenteil: Sie freute sich, dass er nachgefragt hat. Ehrliches Interesse wird mehr geschätzt, als so zu tun, als ob man alles versteht.
Typische Stolperfallen im Arztalltag
- Zahlen: „sächzäh“ (16) und „sibezäh“ (17) klingen für deutsche Ohren fast gleich. Bei Medikamentendosierungen kann das schnell heikel werden.
- Zeitangaben: „am halbi vieri“ ist 15:30 Uhr, nicht 3:30 Uhr nachts.
- Wörter mit anderer Bedeutung: „spannen“ heißt nicht „etwas ist spannend“, sondern „es zieht“.
- Redewendungen: „es isch guet“ bedeutet oft nicht Zustimmung, sondern kann auch ein höfliches „eigentlich nicht“ sein.
Was Patienten wirklich verstehen – und was nicht
Natürlich verstehen die meisten Patienten Hochdeutsch – besonders in Städten oder bei jüngeren Menschen. Aber: Sie fühlen sich wohler, wenn du ein Stück weit ihre Sprache sprichst.
Gerade ältere Patienten oder Menschen auf dem Land öffnen sich schneller, wenn du ein paar Dialektwörter übernimmst: „Grüezi“, „Merci vilmal“, „e guete Besserig“. Das wirkt nicht künstlich, sondern respektvoll.
Insider-Tipps aus der Beratung
- Der 80/20-Trick: Du musst kein perfektes Schweizerdeutsch sprechen. Aber wenn du 20 Schlüsselwörter lernst (Zahlen, Begrüßungen, Beschwerden), bist du schon bei 80 % der Verständigungssicherheit.
- Nachfragen positiv drehen: Sag nicht „ich hab nichts verstanden“, sondern „ich möchte sicher sein, dass ich Sie richtig verstanden habe“. So wirkst du professionell, statt unsicher.
- Dialekt gezielt nutzen: Ein Arzt erzählte mir, dass er nur in Smalltalk-Situationen Dialektwörter einsetzt („Wie goht’s?“, „Alles guet?“). In der medizinischen Erklärung bleibt er konsequent bei Hochdeutsch – ein guter Mittelweg.
Fazit
Schweizerdeutsch ist kein Hindernis, sondern ein Türöffner. Es entscheidet oft darüber, wie schnell du das Vertrauen deiner Patienten gewinnst. Du musst es nicht perfekt sprechen – aber wenn du zuhören lernst, gezielt nachfragst und einzelne Dialektwörter übernimmst, bist du im Alltag klar im Vorteil.
Sprache ist nur ein Teil deiner Integration als Arzt in der Schweiz – fachlich, kulturell und menschlich. Genau dabei unterstütze ich dich in meiner persönlichen Beratung.
Dein nächster Schritt
📝 Hol dir jetzt deinen kostenlosen Leitfaden (63 Seiten) als Arzt in der Schweiz für deine Vorbereitung auf den Schritt in die Schweiz!
➡️ Hier kostenlos downloaden
👉 Buche jetzt deine individuelle Videoberatung für Ärzte, die in die Schweiz auswandern und arbeiten wollen!
➡️ Hier klicken und Termin sichern
